73 (alt: 238)
Haus unterhalb der Gasse.
nach dem Brand 1857 neu erbaut.
1881: Dinkler, Karl, Olitätenhändler.
1906: Dinkler, Carl, Laborant (ohne Nr.).
1909: Dinkler, Karl, Laborant (ohne Nr.).
1913: Dinkler, Max, Kaufmann & geb. Eberhardt, Clara.
1921: Dinkler, Karl, chemisch-pharmazeutische Präparate, Thüringer Spezialitäten (gegründet 1869), Holzdreherei.
1931: Dinkler, Karl, chemisch-pharmazeutische Präparate (seit 1869), Thüringer Spezialitäten, Holzdreherei; Dinkler, Max, chemisch-pharmazeutische Präparate, Thüringer Spezialitäten; Hertlein, Edmund, Studien-Assessor.
1933: Dinkler, Karl, Architekt; Dinkler, Max, Laborant; Schramm, Fritz, Bürovorsteher.
1936: Dinkler, Karl, Architekt; Dinkler, Max, Laborant.
1941: Dinkler, Hans, Drogist; Dinkler, Karl, Architekt; Dinkler, Max, Laborant.
1949: Alzen, Ilse, Hausfrau; Dinkler, Max, Kaufmann; Dinkler, Karl, Kaufmann; Steller, Anna, Hausfrau.
1956: Dinkler, Karl, chemisch-pharmazeutische Fabrik.
1975: Götze, Fritz.
Stammbaum Dinkler vorhanden.
74 (alt: 240)
1857: Holzhey, Willy, ungefährer Ausbruchsort des großen Brandes 1857.
1921: Henkel, Alfred, Landwirt (bis 1949).
1933: Henkel, Anna, Landwirtin.
später: Horn.
75 (alt: 241)
„Sixer“ (Heinz Nippold)
(?): Preßler, Emil; Preßler, Rosa.
1919: Henkel, Paul; Henkel, Ella Clara.
1921: Henkel, Emil, Oberpostschaffner (bis 1931); Henkel, Paul, Glasbläser (bis 1949); Richter, Moritz, Fleischer (bis 1931).
1933: Hofmann, Friedrich, Dekorationsmaler.
1949: Preßler, Rosa, Witwe.
später: Nippold.
76 (alt: 242)
1881: Danz, Traugott, Klempner.
1921: Arndt, Ferdinand, Postschaffner, Danz, Traugott, Klempnermeister.
1931: Klötzer, Fritz, Lehrer (bis 1933).
1933: Danz, Helene (bis 1949); Danz, Ida.
1936: Wilhelm, Rudolf, Lehrer.
1941: Wilhelm, Paul, Sparkassenangestellter.
1949: Rottenau, Kurt, Schuhmacher; Schwabe, Karl, Elektriker; Wosnitz, Ferdinand, Bauarbeiter.
Ohne Nr.
1958 (?): altes Feuerwehrgerätehaus (hinter Kantorat, bis 1975).
77 (alt: 243)
Mathildenstiftung
1893: Mathildenstiftung.
1898: Mathildenstiftung.
1921: Schwester Louise, Mathildenstiftung.
1931: Walther, Rudolf, Gemeinderechnungsführer.
1933: Buchmann, Eline, Diakonisse; Rothe, Lina, Diakonisse; Walther, Rudolf, Gemeinderechnungsführer.
1936: Jahn, Louise, Diakonisse.
„Schwester Ella“ (1946 bis 1977 in Oberweißbach), starb mit über 100 Jahren in Eisenach.
1975: Ullrich, Fritz.
DDR-Zeit: Ev. Kantorat.
heute: Ev. Kantorat.
Weitere Quellen: Staatsarchiv Rudolstadt.
? (alt: 243a)
1921: Lattermann, Rudolf, Bäcker.
78 (alt: 244 und 244a)
1881: Himmelreich, Gottfried, Fleischer.
1896: Vogelmann, Ernst, Fleischer (Eigentümer: Himmelreich, Gottfried).
1896: Dachstuhlbrand.
1921: Eichhorn, Emil, Laborant; Köhler, Kurt; Köhler, Lonny.
1930: Schneider, Max; Schneider, Ella.
1931: Hampe, Otto, Fabrikant; Kleber, Kurt, Glasbläser.
1933: Köhler, Kurt, Glasbläser (alt: 244a); Schamberger, Hermann, Vollziehungsbeamter; Schneider, Otto, Glasbläser; Walther, Anna, Glasarbeiterin.
1936: Bauer, Otto, Glasbläser; Köhler, Kurt, Glasbläser; Schneider, Otto, Glasbläser.
1941: Bauer, Otto, Glasbläser; Jahn, Alfred, Glasbläser; Köhler, Kurt, Glasbläser; Schneider, Otto, Glasbläser.
1949: Jahn, Alfred, Glasbläser; Köhler, Kurt, Arbeiter; Schneider, Max, Glasbläser.
später: Ehle, Dieter (†) & Helga, Blumenladen.
79 (alt: 245)
Apotheke
1732: Apotheke und Drogenhandlung von Friedrich Karl Langenbeck Nachfolger.
1826: Dr. Worm und Schönauische Apotheke.
1864 brennt das hinter der Apotheke befindliche Schönau‘sche Gartenhaus – vormals ein repräsentatives Bauwerk u.a. mit Marmortreppen – komplett ab. Zuletzt befand sich darin eine Zündholzfabrik.
1881: Apotheke „Dr. Worm & Schönau“, Inh. Richard Hopfe.
1895, 1. September: Explosion, Apotheker Hopfe (verbrannt) und Provisor Ehrhardt (zerrissen) kommen ums Leben, Handelsmann Oskar Liebmann wird verletzt (Haare brennen, kann sich zum Brunnen (welchen?) retten).
1906: Langenbeck, Fr. Karl, Apotheker, Fabrik pharmaz. Präparate (ohne Nr.).
1909: Langenbeck, Fr. Karl, Nachf., Inh. Apotheker Simon, Apotheke und Fabrik pharmazeut. Präparate.
1921: Friedrich Karl Langenbeck Nachfolger.
1930: Stöhr, Max, Kraftwagenführer, Stöhr, Else.
1931: Böttger, Max, Schneider; Hentschel, Hans, Apotheker; Heppe, Karl, Apotheker.
1933: Bauer, Grete, Angestellte; Busch, Thora, Pensionärin; Göhring, Hedwig; Hentschel, Hans, Apotheke u. chem.-pharmaz. Fabrik; Hertlein, Eduard, Studienrat; Jahn, Louise, Diakonisse; Pröschold, Otto, Fabrikant; Schmidt, Hugo, Glasbläser; Schüssler, Wulf, Apotheker.
1936: Henschel, Hans, Apotheker; Henschel, Annemarie, geb. Lichtenheldt (aus Meuselbach).
1941: Henschel, Hans, Apotheker.
1949: Henschel, Hans, Apotheker; Kliche, Charlotte, Hausfrau; Marotz, Brunhilde, Apothekerin; Naujukat, Fritz, Holzhauer; Steinig, Ida, Reinemachfrau.
1967: Apotheker Manfred Heyder.
heute: Fröbel-Apotheke, Susann Gutheil.
79a
80 (Alt: 246)
„Trautners Haus“.
Wohnhaus Richard Trautner: Richard Trautner, eigentlich Adolf Richard Trautner, wurde geboren am 12.02.1846 in Trockenborn bei Kahla. Von Beruf war er Gerichtsvollzieher.
1885 gründet Trautner den Zweigverein Oberweißbach des Thüringerwald-Vereins.
Am 8. Januar 1886 beauftragt er den Bezirksbaumeister mit der Anfertigung eines Risses zur Errichtung des Fröbelturms. Diese Idee ist für Trautner Anlass, am 21. April 1887 auch den Fröbelverein ins Leben zu rufen.
Zum 106. Geburtstag Fröbels, am 21.April 1888 um 16:00 Uhr wird der Grundstein zum Fröbelturm gelegt. Richard Trautner spricht die Worte zum Festakt.
Unter reger Anteilnahme der Bevölkerung – es sind etwa 2.000 Personen – wird am 27. Juli 1890 der Fröbelturm eingeweiht. Bürgermeister Eberhardt hält die Begrüßungsrede, Pfarrer Rausch vom Fröbelverein die Festrede.
Richard Trautner ist von 1898 bis 1913 im Thüringer Landesfeuerwehrverband tätig und setzt sich dort vor allem für die soziale Absicherung und den Versicherungsschutz der Feuerwehrangehörigen ein. Als Bezirksbrandmeister vertritt er um 1900 den Feuerwehr-Verbandsbezirk III Oberweißbach.
Am 7. Januar 1924 stirbt Richard Trautner in Oberweißbach an Leberkrebs.
Quellen zu Richard Trautner im Staatsarchiv Rudolstadt
(?): Graf, Edmund; Graf, Frieda.
1921: Hampe, Auguste, Handelsfrau; Neo Iso Werke.
1925: Hertwig, Fritz; Hertwig, Klara.
1931: Bäckerei Bruno Thiemich; Schubert, Hermann, Gerichtsvollzieher; Tragsdorf, Paul, Lehrer; Lenk, Leopold Max, Holzarbeiter; Schmidt, Karl Otto, Amtsgerichtsrat; Appelfeller, Peter, Zinographik (?); Graf, Edmund, Glasbläser; Bäckerei Taubeneck (?).
1933: Conradi, Max, Arbeiter; Graf, Edmund, Glasbläser; Graf, Kurt, Glasbläser; Graf, Rudolf, Glasbläser; Hertwig, Fritz, Glasbläser; Müller, Emmy, Hausgehilfin; Müller, Gustav, Glaswarenfabrik; Müller, Rosa, Hausgehilfin; Thiemich, Bruno, Bäckermeister.
1935: Bock, Max; Bock, Gertrud.
1936: Brödel, Karl, Graveur; Conradi, Max, Arbeiter; Galander, Paul, Bäcker; Graf, Edmund, Glasbläser; Hertwig, Fritz, Glasbläser; Müller, Gustav, Glasbläser; Schmidt, Hugo, Glasbläser; Ulrich, Fritz, Arbeiter.
1937: Dachstuhlbrand.
1941: Brödel, Karl, Graveur; Galander, Paul, Bäcker; Conradi, Max, Arbeiter; Galander, Paul, Bäcker; Graf, Edmund, Glasbläser; Hampe, Karl, Dekorationsmaler; Hertwig, Fritz, Glasbläser; Höhne, Heinz, Stud.-Ass.; Kliche, Robert, Apotheker; Lehmann, August, Rentner; Müller, Gustav, Glasbläser; Schmidt, Hugo, Glasbläser; Ulrich, Fritz, Arbeiter; Wilhelm, Heinz, Gewerbelehrer.
1949: Bock, Max, Zimmermann; Erler, Josef, Zimmermann; Graf, Roland, Glasbläser; Graf, Edmund, Glasbläser; Hertwig, Louis, Desinfektor; Hertwig, Fritz, Glasbläser; Lehmann, Margarete, Witwe; Marek, Alois, Arbeiter; Pidde, Gertrud, Glasarbeiterin; Rischer, Hildegard, Arbeiterin; Schall, Hermann, Studienrat; Schindler, Elfriede, Glasarbeiterin; Stanka, Emil, Bauarbeiter; Treichel, Kurt, Arbeiter; Werner, Emil, Arbeiter.
1956: Taubeneck, Walther.
1975: Matz, Ewald, Bäckerei.
DDR-Zeit: Bäckerei Taubeneck; Bäckerei Ewald Matz.
2005: Dachstuhlbrand.
80a
81 (alt: 247)
„Suppe“ (Karl-Heinz Schöler)
1921: Ehrhardt, Alfred, Sattlermeister (bis 1941); Heißer, Edmund, Friseur; Lindner, Hugo, Bureauvorsteher, Gerichtsassistent, Kanzleiangestellter, Justizangestellter (bis 1949).
1936: Appelfeller, Peter, Kopierer.
1949: Lindner, Wuni, kaufm. Angestellte.
(?): Bergmann, Rudolf, Thermometermacher (bis 1949); Bergmann, Rosa.
1920: Wiegand, Otto, Glasbläser (bis 1949); Wiegand, Elise.
1921: Himmelreich, Hulda, Tagelöhnerin (bis 1931); Himmelreich, Paul, Briefträger; Wiegand, Otto, Glasbläser (bis 1949).
1933: Himmelreich, Auguste, Hausgehilfin; Himmelreich, Hermine, Aufwärterin (bis 1941).
1936: Himmelreich, Erich, Glasbläser (bis 1941); Himmel-reich, Anne.
1949: Wisser, Fritz, Glasbläser.
83 (alt: 249)
„Cornel“
(Cornelius Franke, Ernst Franke, dann Günther Franke)
1921: Ehrhardt, Gustav, Maurer; Franke, Cornelius, Glasermeister (bis 1933).
1933: Franke, Ernst, Glaser; Reise, Kurt, Glasbläser.
1935: Franke, Ernst, Glaser („Cornel“ – bis 1949); Franke, Martha Rosa.
1936: Franke, Anna, Witwe (bis 1949); Reise, Kurt, Glasbläser (bis 1941).
1949: Stelzer, Martha, Hausfrau; Worm, Elise, Witwe.
später: Franke, Günther („Cornel“).
Günther, wir brauchen eine Holzkiste: 3 m breit, 3 m lang, 2,50 m hoch! Kein Problem für „Cornel“! Eifrig baut er in seiner Werk-statt die gewünschte Holzkiste – Ehrensache! Doch ach! Der Auftrag war ein Schabernack! Die Kiste ist nämlich viel zu groß, um sie durch Tür oder Fenster ins Freie zu transportieren. Was wohl aus der Kiste wurde?
Günther Franke, der letzte einer über 100-jährigen Glaser-Familie, hat sich 2024 das Leben genommen …
84 (Alt: 250) – abgerissen
1921: von Ende, Adolf; Worm, Emil, Handelsmann (bis 1941).
1923: Worm, Hugo, Glasbläser (bis 1949); Worm, Paula.
1949: Ehrhardt, Emmy, Hausfrau; Groschup, Franz, Straßenarbeiter.
zuletzt: Worm, Lothar.
Und hier haben wir einen weiteren „Abenteuer-Spielplatz“ in Oberweißbach. Nachdem das seit Jahren unbewohnte Haus zunächst als Übungsobjekt der Feuerwehr diente, wurde es vor einigen Jahren wegen Einsturzgefahr platt gemacht. Übrig blieb ein großer Trümmerhaufen, auf dem inzwischen Bäume wachsen. Oder verstehe ich hier einfach nur etwas falsch? Es könnte sich ebenso gut um die vom „dicken Kohl“ versprochenen „blühenden Landschaften“ handeln! Es blüht dort wirklich! Also! Was soll das Gejammer?
85 (alt: 251)
„Spediteurs“
1904: Schneider, Karl, Thermometermacher.
1904: Am 17.09.1904 brennen Stall und Scheune dieses Anwesens komplett nieder.
1915: Walther, Ernst, Postschaffner; Walther, Helene.
1921: Schneider, Karl sen., Thermometerfabrikant.
1931: Pichuleck, Karl; Walther, Ernst, Postschaffner.
1933: Escher, Ernst, Telegrafen-Leitungsaufseher, seit 1925 Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Oberweißbach, (1936 in der Lichtenhainer Straße 14); Escher, Rudi, Buchdrucker; Walther, Ernst, Postschaffner.
1936: Walther, Ernst, Postschaffner.
1941: Ulrich, Hugo, Glasbläser; Walther, Ernst, Postschaffner; Walther, Paul, Hilfsarbeiter.
1949: Hujer, Pauline, Hausfrau; Walther, Ernst, Postschaffner (Er (?) fuhr später einen PKW, der eine Mischung aus „Wartburg“ und „Mercedes“ war – vorne Mercedes – hinten Wartburg); Walther, Paul, Glasbläser.
1975: Henkel, Theo, Elektromonteur.
86 (alt: 252)
(?): Hattop, Waldemar, Glasbläsermeister (bis 1949); Hattop, Gertrud.
1921: Hattop, Karl, Bäckermeister (bis 1941).
1949: Hattop, Hermann, Bäcker; Kayser, Nanny, Glasarbeiterin; Liebmann, Agnes, Näherin.
später: Seel.
87 (alt: 253)
1906: Walther, Oskar, Laborantengeschäft (ohne Nr. – bis 1921).
1931: Escher, Ernst, Telegraphen-Leitungsaufseher; Walther, Emma, Laborantin (bis 1933).
1933: Albrecht, Otto, Postschaffner (bis 1936).
1936: Götze, Rudolf, Glasbläser (bis 1941).
1949: Bauer, Otto, Glasbläser; Eckhard, Otto, Kunstmaler; Franke, Hugo, chem. Arbeiter; Paege, Johanna, Hausgehilfin.
1975: Köhler, Siegfried.
87a
Bischoff.
88 (alt: 254)
„Onkel Hans“
1921: Jahn, Otto, Schlossermeister (bis 1941); Jahn, Paul, Schlosser, Kohlehändler (bis 1956); Jahn, Martha, geb. Preunel (Kohlen¬handlung & Biergroßverlag).
1922: Jahn, Mathilde Annemarie.
1924: Jahn, Lieselotte Ilse.
1929: Jahn, Oskar Rolf.
1933: Ehrhardt, Anna, Glasarbeiterin (bis 1941); Ehrhardt, Lonny, Glasarbeiterin.
1949: Jahn, Rolf, Kraftfahrer.
1956: Jahn, Paul & Rolf, Lastfuhren.
1975: Arnoldt, Hans, Kohlehandlung in Komm. VEB Kohlehandel Suhl.
DDR-Zeit: Arnoldt, Hans, „Onkel Hans“, Kohlehandel.
später: Burkhardt, Anette, Getränkehandel.
Was zum Teufel ist ein Bierverlag?
Ganz einfach! Bier wurde früher nicht in Flaschen, sondern in Holzfässern zu einem sog. „Verleger“ transportiert. Der hat dann das kühle Blonde mittels einer Abfüllanlage in Flaschen abgefüllt, verkorkt und anschließend verkauft. So hielt es auch meine Ur-Großmutter Ida Lichtenheldt, geb. Franke. Die war zwar kein Verleger, aber sie betrieb eine Flaschenbierhandlung.
Dass genau hier nach der Wende wieder ein Handelsgeschäft mit Bier entstand, ist vielleicht kein Zufall (Anette Burkhardt, Getränkehandel).
89 (alt: 255)
(?): Bähring, Liebrecht, Glasbläser (bis 1941); Bähring, Anna Rosa, geb. Fichtmüller.
1921: Ehrhardt, Amalie, Perlenmacherin; Wallenhauer, Ernestine, Tagelöhnerin; Witzmann, Hugo, Barbier.
1933: Bähring, Dora, Glasarbeiterin; Bähring, Helene, Glasarbeiterin; Schwabe, Erich, Glasbläser.
1936: Ehrhardt, Rudolf, Glasbläser (bis 1949); Ehrhardt, Helene.
90 (alt: 256-257)
1881: Wiegand, Wilhelm, Kleiderhandlung.
(?): Schneider, Alfred; Schneider, Frieda.
1921: Bärschneider, Otto, Glasarbeiter (257); Schneider, Alfred, Thermometermacher (256); Spiegelberg, Reinhold, Bäcker (256); Trautner, Richard, Gerichtsvollzieher a. D. (256); Wiegand, Wilhelm, Schuhmacher (257).
1931: Schmeißer, Hermann, Handelsmann (257); Schneider, Alfred, Thermometermacher (256); Spiegelberg, Reinhold, Packer (256); Trautner, Clara, Witwe (256).
1933: Bock, Hugo, Holzhauer (257); Schmeißer, Hermann, Gemüsehändler (257); Schneider, Alfred, Glasbläser (256); Spiegelberg, Reinhold, Packer (256); Spiegelberg, Waltraud, Packerin (256).
1936: Löchner, Anselm, Glasbläser; Schneider, Alfred, Glasbläser.
1941: Löchner, Anselm, Glasbläser; Schneider, Alfred, Glasbläser.
1949: Henkel, Magdalene, Glasarbeiterin; Schneider, Alfred, Glasbläser.
zuletzt: Fischer, Helmut (†).
91 (alt: 258 und 258a) – abgerissen.
(?): Schmeißer, Ludwig; Schmeißer, Helene.
1921: Fehn, Wilhelm, Sattlermeister (bis 1936).
1930: Bock, Hugo, Hutmann (bis 1941; Bock, Erna.
1931: Appelfeller, Hans, Glasbläser (258a); Appelfeller, Max, Glasbläser (258a).
1933: Fehn, Liesbeth, Kontoristin.
1936: Schmeisser, Helene, Glasarbeiterin (bis 1949); Gräf, Karl, Glasbläser (bis 1949); Schneider, Emmy Hertha.
1941: Schmeisser, Oskar, Hilfsarbeiter.
92 (siehe oben 258a)
(?): Fehn, Wilhelm; Fehn, Hertha.
1949: Dittrich, Ferdinand, Maurer; Fehn, Bertha, Witwe.
später: Müller, Alfred „Bremsknüttel“, Fam. Otto.
später: Klimm.
93 (alt: 259)
1921: Breternitz, Alfred, Glasbläser (bis 1949); Breternitz, Marie; Ludwig, Louis, Schieferbrucharbeiter.
1931: Ludwig, Emma, Witwe (bis 1933).
später: Hofmann.
94 (alt: 259a)
Haus weiter hinten.
1921: Enders, Liebrecht, Packer (bis 1933); Gunschmann, Alfred, Waldarbeiter (bis 1931).
1933: Enders, Erna, Hausgehilfin; Enders, Karl, Glasbläser (bis nach 1955).
später: Himmelreich.
95 (Alt: 260)
(?): Bauer, Emil, Maurer (bis 1949); Bauer, Ida.
1921: Bergmann, Heinrich, Nachtwächter (bis 1931); Walther, Rudolf, Glasbläser.
1923: Bauer, Max, Kraftwagenführer (bis 1949); Bauer, Linda.
1929: Scherf, Hugo, Glasbläser (bis 1949), Scherf, Rosa.
1933: Bauer, Kurt, Handlungsgehilfe.
1949: Bauer, Max, Landwirt; Goppold, Barbara, Witwe.
später: Bauer, Edgar, Arztfahrer.
96 (alt: 261)
1921: Jahn, Albert, Graveur, Porzellan- und Glashandlung (bis 1941).
1933: Jahn, Rudolf, Kaufmann.
1936: Jahn, Rudolf; Jahn, Johanna.
1949: Eichhorn, Heinz, kaufm. Angestellter; Kichler, Oskar, Invalid.
1950: Am 31.12.1950 Scheunenbrand bei Reise.
1975: VEB Glasverarbeitung Neuhaus.
später: Schulz, Wilhelm.
97 (alt: 262)
„unterer Konsum“
1909: Konsum- und Produktivverein egmbH.
1921: Consumverein.
(?): Opradruy, Karl, Lagerhalter (KONSUM); Opradruy, Gertrud.
1931: Becker, Johannes, Konsum-Geschäftsführer; Consumverein; Konsum- und Produktivverein, Opradruy, Karl, Lagerhalter; Bäckerei Karl Bock (vor 1936 aufgegeben); Dietrich, Fritz, Konsumgeschäftsführer.
1933: Dietrich, Fritz, Geschäftsführer; Opradruy, Karl, Lagerhalter.
1936: Dietrich, Fritz, Geschäftsführer; Opradruy, Karl, Lagerhalter; Verbrauchergenossenschaft eGmbH Oberweißbach.
1941: Dietrich, Fritz, Geschäftsführer; Opradruy, Karl, Lagerhalter; Verbrauchergenossenschaft eGmbH.
1949: Bock, Rosa, Hausfrau; Ehrhardt, Oskar, Lagerhalter.
1956: KONSUM Fleischwaren.
bis
1960er Jahre: KONSUM- Bäckerei: angestellt: Bäcker Hattop, Otto Bock; als
Rentner zeitweise: Beck, Karl Bock.
1975: KONSUM Lebensmittel.
DDR-Zeit: KONSUM Lebensmittel (Christine Beyer: „Un was’n noch?“), Fleischerei Bornkessel.
nach der Wende: Lebensmittelgeschäft Sommer, dann Schmidt.
heute: Heval-Döhner.
Den Namen „Opradruy“ kann ich trotz intensiver Recherchen nirgends nachweisen.
98 (alt: 263)
Hier scheint einiges durcheinander zu gehen – Verwechslung der Hausnummern 98 und 99?
(?): Heunemann, Paul, Graveur; Heunemann, Bertha, geb. Löser (eine heimliche Prinzessin 😊).
1921: Franke, Reinhold, Porzellanmaler; Götze, Rudolf, Glasbläser.
1924: Appelfeller, Oskar; Appelfeller, Emilie.
1933: Galander, Paul, Bäcker; Heunemann, Elsa, Glasarbeiterin; Heunemann, Magdalene, Glasarbeiterin, Heunemann, Margarete, Glasarbeiterin, Heunemann, Paul, Graveur.
1936: Appelfeller, Oskar, Zimmermann; Heunemann, Paul, Graveur; Heunemann, Paul, Graveur.
1941: Appelfeller, Oskar, Zimmermann; Heunemann, Paul, Graveur.
1949: Heunemann, Berta, Witwe; Wilhelm, Hermann, Glasbläser.
1954: mit Rudolstädter Straße 99 abgebrannt.
DDR-Zeit: Walter und Else Taubeneck / Helmut & Karin Heyn.
1921: Appelfeller, Oskar, Zimmermann (bis 1933).
1933: Voigt, Emilie.
1934: Appelfeller, Rudolf, Zimmermann (bis 1949); Appel-feller, Martha.
1936: Thieme, Marie, Schwester.
1937: Ludwig, Alfred.
FC
1954: Dieses Haus brannte am 23.12.1954 ab. Die Kinder aus diesem
und dem Nachbarhaus wurden zunächst nach Rudolstädter Straße 47 (Dumdei)
gerettet. Das Haus wurde nicht wieder aufgebaut. Neues Haus Fröbelstraße 51.
Die Familie Appelfeller hatte 7 Kinder – alles Mädchen! Einige - es kann sich nur um die Kleinsten handeln - sind vielleicht auf dem Foto zu sehen.
100 (alt: 265)
1921: Kunold, Louis, Gerichtsvollzieher.
1931: Kunold, Ida, Witwe (bis 1941); Liebert, Franz Hans, Glasbläser; Liebert, Elise, Gertrud, Marie (bis 1933).
1933: Kunold, Hermann, Prokurist (bis 1936).
1941: Sorge, Max, Buchhalter.
1949: Ludwig, Max, Fabrikant; Ludwig, Martha, Witwe.
später: Wicklein.
101 (alt: 266)
1881: Vogelmann, Emil, Olitätenhändler (in diesem Haus?).
(?): Vogelmann, Fritz, Laborant, Kaufmann (bis 1949); Vogelmann, Rosa.
1928: Koch, Willy, Kaufmann (bis 1941); Koch, Uda (?).
1933: Walther, Karl, Geschäftsführer; Wilhelm, Ida, Rentnerin.
1936: Wilhelm, Elise, Glasarbeiterin (bis 1949).
1949: Funk, Marie, Hausfrau; Wilhelm, Rudolf, Buchhalter.
später: Speiser.
102 (alt: 267-268)
„Schönstedt“
1908: Vogelmann, Fritz.
1921: Kämpfe, Adolf, Gerichtsassessor; Trapp, Cäsar, Bäckermeister (268); Vogelmann, Fritz, Laborant.
1931: Trapp, Cäsar, Bäckermeister (268); Trapp, Rudolf, Laborant (268); Wilhelm, Ida, Perlenmacherin; Walther, Karl, Krankenkassengeschäftsführer; Vogelmann, Fritz, Laborant.
1933: Trapp, Cäsar, Bäckermeister; Trapp, Eduard, Kaufmann; Trapp, Elly; Trapp, Rudolf, Laborant (alle 268).
1936: Trapp, Cäsar, Bäckermeister.
1941: Trapp, Cäsar, Bäckermeister.
1949: Heinrich, Günther, Schlosser; Heinrich, Robert, Schmied; Hofmann, Hedwig, Hausfrau; Lux, Erich, Prokurist; Weidl, Anton, Rentner.
1975: Kooperationsgemeinschaft Schönstedt, Ferienheim.
letzte Besitzerin: Frau Heinrich.
Dieses einst repräsentative Gebäude wurde zu DDR-Zeiten zum Ferienheim umgebaut. Durch den vorderen Anbau entstanden Garagen und ein schöner Gastraum, wofür allerdings die hohe Treppe und der portalartige Haupteingang weichen mussten.
Nach der Wende diente das Hintergebäude als Wohnung für sozial schwache Familien, dann als Unterkunft für Asylbewerber. Derzeit ist das gesamte Gebäude dem Verfall preisgegeben. Vage Planungen gehen dahin, die Ruine im Zuge der geplanten (und immer wieder verschobenen) Sanierung der gesamten Ortsdurchfahrt abzureißen und hier eine Straße zum Hinterweg als mögliche Umleitung zu schaffen. Allein: Wer soll das bezahlen in einem aussterbenden Ort?
103 (alt: 268a)
1908: Wallenhauer, Albin.
1921: Appelfeller, Alfred, Fabrikant, Glaswaren (bis 1975).
1924: Appelfeller, Max; Appelfeller, Nanny.
1933: Appelfeller, Erich, Glasbläser; Appelfeller, Klara, Glasarbeiterin; Appelfeller, Max, Glasbläser, Verwaltungsangestellter (bis 1949).
später: Appelfeller, Hartmut (†) & Hilde.
Anni Ulrich, geb. Gräf
104 (alt: 269)
1931: Gräf, geb. Ulrich, Anni; Ulrich, Karl, Angestellter der Bergbahn (bis 1949).
1933: Ulrich, Arno, Milchhändler; Ulrich, Emil, Gemüsehändler (bis 1941).
1949: Gräf, Anneliese (Anni – bis in die 1970er Jahre), Glasarbeiterin.
später: König.
Unbestätigten Erzählungen zufolge sollen bei Baumaßnahmen vor diesem Haus Hinweise auf ein früher dort befindliches Brauhaus entdeckt worden sein. Weiß jemand etwas darüber?
105 (alt: 270)
(?): Bergmann, Paul, Glasbläser, chem. Arbeiter (bis 1949); Bergmann, Elise.
1921: Bergmann, Louis, Oberpostschaffner (bis 1933).
DDR-Zeit und später: Albrecht Willi (†) & Erika (†).
106 (alt: 271)
(?): Graf, Kurt; Graf, Helene.
1921: Anders, Emil, Korbmacher (bis 1933), Anders Otto, Korbmacher (bis 1949); Anders, Ella.
später: Leopold.
Die Korbmacherei muss noch bis in die späten 1960er Jahre bestanden haben, da ich mich noch an den Innenraum erinnern kann.
107 (alt: 272)
Haus steht zurückgesetzt.
1921: Appelfeller, Traugott, Zimmermeister.
1931: Appelfeller, Paul, Glasbläser (bis 1941).
1949: Brödel, Karl, Photograph; Dumdei, Erich, Photogehilfe.
Vom Fotografen Brödel hat sicher so mancher Oberweißbacher noch Fotos – und weiß es vielleicht gar nicht?
„Schwarzens Lücke“
108 (alt: 273)
„bei Schwarzens“
1921: Franke, Berta, Handelsfrau (bis 1931).
1933: Paschold, Oskar, Stadtförster (bis 1949).
1949: Kostyra, Anna, Glasarbeiterin; Kunold, Helene, Hausfrau.
1975: Heinle, Arthur, Küchenmeister.
109 (alt: 274)
1921: Köhler, Otto, Gaswerksarbeiter; Schneider, Rudolf, Glasbläser.
1926: Köhler, Karl; Köhler, Ida.
1927: Nentwich, Heinrich; Nentwich, Elise, geb. Lichtenheldt.
1929: Graf, Alfred; Graf, Greta.
1931: Kleber, Karl, Schlosser; Köhler, Otto, Gaswerksarbeiter.
1932: Köhler, Alfred; Köhler, Rosa.
1933: Graf, Alfred, Maurer; Köhler, Alfred, Glasbläser; Köhler, Karl, Schlosser; Köhler, Otto, Heizer.
1936: Köhler, Alfred, Glasbläser; Köhler, Karl, Schlosser; Köhler, Otto, Arbeiter; Leopold, Emmeline, Witwe.
1941: Köhler, Alfred, Glasbläser; Köhler, Karl, Schlosser; Köhler, Otto, Arbeiter.
1949: Graf, Alfred, Glasbläser; Köhler, Martha, Hausfrau; Köhler, Karl, Schlosser.
später: Hösl.
110 (alt: 275)
(?): Schöler, Ernst, Tischlermeister (bis 1941); Schöler, Luise.
1929: Schöler, Fritz, Tischler (bis 1933); Schöler, Milda.
1933: Schöler, Max, Handlungsgehilfe, Glasbläser (bis 1949).
später: Ott.
111 (alt: 276)
(?): Winzer, Erwin, Materialwarenladen, Drogenhandlung (bis 1941); Winzer, Agnes.
1931: Winzer, Erwin, Drogenhandlung, später: Ella Winzer (hatte eine Mohnpresse im Hausflur).
1933: Winzer, Erich, Handlungsgehilfe.
1949: Winzer, Agnes, Geschäftsinhaberin.
später: Fünfstück.
112 und 113 (alt: 277 und 278)
112 („Ulla“) – 113 „bei Klebers“
Zusammenhang 112 und 113 unklar: 1900 = 2 Häuser (zwei Brände 1900 und 1904, beides Brandstiftung). Außerdem verfügte der alte „Thüringer Hof“ (113) über eine Kegelbahn, die wohl das Ziel einer der beiden Brandstiftungen war.
1881 (unsicher): Lotze, Wilhelm, Olitätenhändler.
1900: Lotze, Emil, Restaurateur (alter „Thüringer Hof“).
1900: Scheunenbrand, vermutlich nach Brandstiftung.
1904: Brand Wohnhaus und Kegelbahn.
1909: Lotze, Emil, Fleischer und Restaurateur.
1914: Hampe, Otto, Glasbläser u. Fabrikant; Hampe, Paula.
1921: Kleber & Schneider, Glaswarenfabrik und Gasthaus „Thüringer Hof“.
bis 1928: Gasthaus „Thüringer Hof“ (278); Roth, Richard, Fleischer und Gastwirt (278).
1931: Kuhn, Erich, Korrespondent (278); Schneider, Albert, Prokurist; Kleber & Schneider, Glaswarenfabrik; Kleber, P., Fabrikant (278).
1933: Berger, Marie, Witwe (278); Hampe, Otto, Glaswaren-fabrikant; Kuhn, Erich, Kaufmann (278); Kleber, Paul, Glas-warenfabrik (278); Richter, Emma, Witwe (278); Schneider, Albert, Glasbläser (278); Wehnert, Margarete (278).
1936: Hampe, Otto, Glaswarenfabrikant; (277); Kleber, Paul, Glaswarenfabrik (278); Kuhn, Erich, Kaufmann (278); Schneider, Albert, Glasbläser (277).
1941: Kleber, Paul, Glaswarenfabrik (278); Kuhn, Erich, Kaufmann (278); Schneider, Albert, Glasbläser (277); Hampe, Otto, Glaswarenfabrikant (277).
1949: Breitenbach, Hildegard, Glasarbeiterin (278); Donatt, Walter, Kraftfahrer (278); Hampe, Otto, Fabrikant (277); Hampe, Roseliese, Hausfrau (277); Kleber, Hiltrud, Geschäftsführerin (278); Kuhn, Erich, Kaufmann (278); Stepanek, Alma, Hausfrau (278).
1956: Kleber, Paul, Glaswaren.
1975: VEB Glasverarbeitung Neuhaus; Kleber, Paul, Glaswaren.
? (alt: 279)
„Hampens Lücke“
Schlange stehen an der unteren Dreschmaschine Rudolstädter Straße 117
114 (alt: 280)
1904: Götze (?).
1921: Hampe, Albin, Schuhmacher (bis 1949).
1931: Hampe, Otto, Schuhmachermeister (bis 1949).
1936: Hampe, Otto, Schuhmachermeister; Hampe, Elly.
später: Hampe, Horst.
115 (alt: 281)
1921: Himmelreich, Albert, Glasermeister (bis 1933); Himmelreich, Idor, Fabrikarbeiter, Landwirt (bis 1949).
1949: Himmelreich, Rudolf, kaufm. Angestellter.
später: Fam. Peter & Irmgard Stolze.
116 (alt: 282)
1921: Neupert, Louis, Handelsmann.
1929: Neupert, Paul & geb. Pfeifer, Marie.
1931: Neupert, Louis, Handelsmann; Paul & Marie Neupert mit Söhnen Hermann und Manfred. (Hermann ist nach Heidenau b. Dresden verzogen).
1933: Neupert, Louis, Landwirt; Neupert, Otto, Handelsmann; Süßenguth, Rudolf, Postkraftwagenführer.
1936: Neupert, Louis, Landwirt; Neupert, Paul, Landwirt.
1941: Neupert, Paul, Landwirt.
1949: Eilhauer, Rudolf, Holzhauer; Neupert, Paul, Thermometermacher.
zuletzt: Neupert, Manfred & Ingrid (†).
117 (alt: 283)
„bei Hillards“.
1881 (unsicher): Hillardt, August, Olitätenhändler.
1921: Unbehaun, Albin, Landwirt.
1924: Neupert, Otto, Handelsmann (bis 1949) & geb. Jahn, Marie.
1949: Helmrich, Ernst, Friseur.
DDR-Zeit: Neupert, Martin, danach Neupert, Hans-Jürgen, Kfz-Werkstatt; Dreschmaschine und Schrotmühle bis 1966, Dreschmaschine danach im Bohnental.
118 (alt: 284)
„bei Fürschtens“ („Schleppsäbel“)
1870: Franke, Gottfried Ludwig, genannt Friedrich & geb. Preunel, Auguste Wilhelmine.
1921: Franke, Gottfried Ludwig (genannt Friedrich), Landwirt; Lichtenheldt, Oskar, Zimmermann.
1929: Lichtenheldt, Ida, geb. Franke.
1931: Lichtenheldt, Oskar, Zimmermann.
1933: Beyer, Paula, Hausgehilfin; Franke, Helene; Lichtenheldt, Oskar, Zimmermann.
1935: Lichtenheldt, Ernst, Fleischer & geb. Preunel, gesch. Sode, Emmy.
1936: Lichtenheldt, Ida, Flaschenbierhandlung (bis 1949).
1946: Lichtenheldt, Kurt & Anna.
1949: Lichtenheldt, Ida, Witwe; Lichtenheldt, Anna, Hausfrau; Lichtenheldt, Emmy, geb. Preunel, Hausfrau.
DDR-Zeit: Lichtenheldt, Anna; Lichtenheldt, Rainer & Inge.
119 (alt: 285)
„bei Schiefners“
1921: Wilhelm, Karl, Kaufmann.
1931: Wilhelm, Otto, Handelsmann; Wilhelm, Rudolf und Martha.
1933: Wilhelm, Otto, Handelsmann; Wilhelm, Rudolf, Glasbläser.
1936: Wilhelm, Bertha, Witwe (bis 1941).
1949: Wilhelm, Rudolf, Glasbläser.
1975: Jahn, Harry.
Der Name „bei Schiefners“ geht zurück auf frühere Bewohner (evtl. Eigentümer), die ich für das Jahr 1839 ermitteln konnte.
120 (alt: 286)
An dieser Stelle befanden sich bis in die späten 1960er bzw. frühen 1970er Jahre zwei Häuser.
1921: Gerhardt, Friedrich, Schuhmacher; Scherf (lt. Adressbuch: „Scharf“), Wilhelmine, Landwirtin.
1931: Scherf, Wilhelmine, Landwirtin.
1933: Gerhard, Emma, Glasarbeiterin; Gerhardt, Franziska, Rentnerin (erscheint 1936 unter Nr. 121); Scherf, Wilhelm, Schuhmacher; Scherf, Wilhelmine, Witwe.
1934: Schneider, Wilhelm, Schuhmacher; Schneider, Gertrud.
1941: Scherf, Wilhelmine, Witwe.
1949: Schneider, Wilhelm, Schuhmacher.
1975: Schneider, Wilhelm.
später: Fam. Kurras.
121 (alt: 286)
gehört jetzt zu 120.
1936: Gerhardt, Franziska, Rentnerin.
1941: Gerhardt, Franziska, Rentnerin; Gerhardt, Walter, Glasbläser.
1949: Haag, Otto, städt. Arbeiter.
122 (alt: 287)
1921: Jahn, Waldemar, Glasbläser; Walther, Emma, Landwirtin; Walther, Alfred; Walther, Ida, geb. Scherf.
1931: Jahn, Waldemar, Glasbläser; Walther, Alfred, Thermometermacher; Walther, Emma, Landwirtin.
1933: Jahn, Ernst, Glasbläser; Jahn, Woldemar, Glasbläser; Schmidt, Paul, Bahnsekretär; Walther, Alfred, Thermometermacher; Walther, Emma, Witwe.
1936: Jahn, Waldemar, Glasbläser; Walther, Alfred, Thermometermacher; Jahn, Ernst; Jahn, Charlotte, geb. Möller.
1941: Jahn, Waldemar, Glasbläser; Walther, Alfred, Thermometermacher.
1949: Gerhard, Franziska, Witwe; Jahn, Lotte, Hausfrau; Walther, Ida, Witwe.
später: Treichel, Hans.
alt: 288 – 288f siehe Friedensstraße.
123 (alt: 288e)
Hier zweigte der Mühlgraben vom Weißbach ab.
1921: Eichhorn, Alfred, Schneider (bis 1931); Köhler, Hugo, Thermo¬metermacher (bis 1949).
1923: Bock, Otto, Bäcker (bis 1941); Bock, Hertha.
1949: Bock, Herta, Hausfrau.
dann: Bock, Paul; Bock, Ursel.
124 (alt: 288f)
1921: Ehrhardt, Rudolf, Maurer (bis 1949).
1941: Ehrhardt, Otto, Glasbläser.
1949: Bergmann, Emmy, Glasarbeiterin.
später: Biehl.
(?) (alt: 288o)
1933: Leopold, Arthur, Holzarbeiter.125 (alt: 289)
1921: Jahn, Hermann, Handelsmann, Thermometermacher (bis 1949).
1931: Jahn, Hans, Glasbläser (bis 1949).
1932: Jahn, Otto, Maurer (bis 1949); Jahn, Martha.
1933: Jahn, Hilda, Glasbläserin.
1936: Müller, Rudi, Glasbläser (bis 1949).
125a (hinter 125)
Götze.
126 (alt: 290)
„Mühle“
„Mühl-Walther“ (Walther Henkel)
1921: Henkel, Oskar, Mahlmüller (bis 1931); Kühn, Karl, Gipsmüller (bis 1933).
1930: Henkel, Fritz; Schmidt, Anna.
1933: Henkel, Frieda, Witwe; Henkel, Fritz, Glasbläser (bis 1949).
1949: Reinauer, Wilhelm, kaufm. Angestellter.
1975: Henkel, Walther, Dipl.-Forstingenieur.
127 (alt: 293?) – abgerissen
1911: Jerzynna, Oskar, Drechsler, Hilfsarbeiter (bis 1933); Jerzynna, Rosamunde.
1921: Jahn & Comp., Alfred, Glaswarenfabrikant (bis 1931).
1933: Jerzynna, Kurt, Bürolehrling; Pabst, Bernhard, Invalide (bis 1941).
1941: Jerzyna, Rosa, Witwe (bis 1949).
128 (alt: 293a)
zwischen oberer und unterer Ausfahrt der ehem. MTS.
1921: Mehlig, August, Gasmeister.
1931: Jahn, Alfred, Fabrikant; Siegmund, Hilmar, Papierarbeiter; Kessel, Otto, Glasschleifer.
1933: Fünfstück, Willy, Rechtsbeistand; Jahn, Alfred, Glaswarenfabrik; Müller, Fritz, Glasbläser; Siegmund, Hilmar, Pappenmacher.
1936: Jahn, Alfred, Glaswarenfabrik; Müller, Fritz, Glasbläser.
1941: Jahn, Alfred, Glaswarenfabrik; Müller, Fritz, Glasbläser; Müller, Klara, Witwe.
1949: Jahn, Wilhelm, Kaufmann; Jahn, Selma, Hausfrau; Kalina, Ernst, Maschinist; Thym Paula, Hausfrau.
129 (alt: 291-293b)
unterhalb Einfahrt zu KFZ-Service Wicklein.
1881: Lattermann, Oskar, Olitätenhändler (in diesem Haus?).
1905: Gaswerk (129a).
1906: Gaswerk Oberweißbach u. Cursdorf GmbH (ohne Nr., vermutl. 129a).
1909: Gaswerk Oberweißbach GmbH.
1921: Bauer, Emilie, Perlenmacherin (292); Koch, Geschwister (292); Lattermann, Oskar, Handelsmann (292); Mackeldanz, Hugo, Handarbeiter (291); Wallenhauer, Oskar, Handarbeiter (291).
1931: Rau, Wilhelm, Gasmeister (bis 1949), Köhler, Karl (293b – bis 1988, letzter Gasmeister).
1949: Rau, Wilhelm, Gasmeister; Schuhmann, Alfred, Schneidermeister.
1956: Maschinen- und Traktorenstation MTS (291).
DDR-Zeit: Köhler, Karl.
später: Rose.
Das Haus unter der Einfahrt und die Fa. KFZ-Service Wicklein gehören beide zu Nr. 129.
130 (alt: 294)
letztes Haus vor der Brücke.
1921: Hoffmann, Karl, Maurer (bis 1949).
1923: Hoffmann, Rudolf, Glasbläser (bis 1949); Hoffmann, Clara.
1926: (unsicher) Bähring, Walther; Bähring, Erna (er seit 1949 Fröbelstraße 12 – Schule).
nach 1945: Mann ohne Beine.
später: Hirschfeld („Käse-Rudi“) vom Hügel kommend.
***







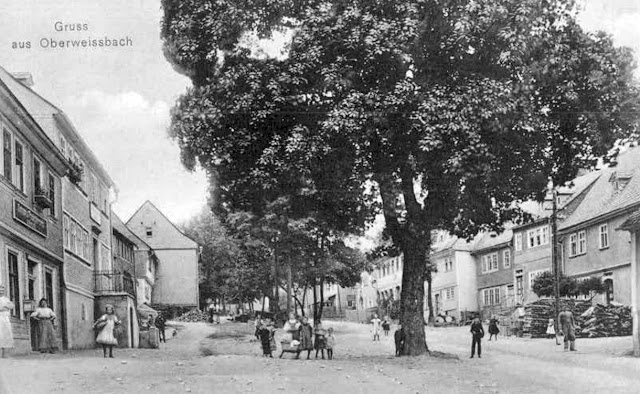














.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)








.jpg)




